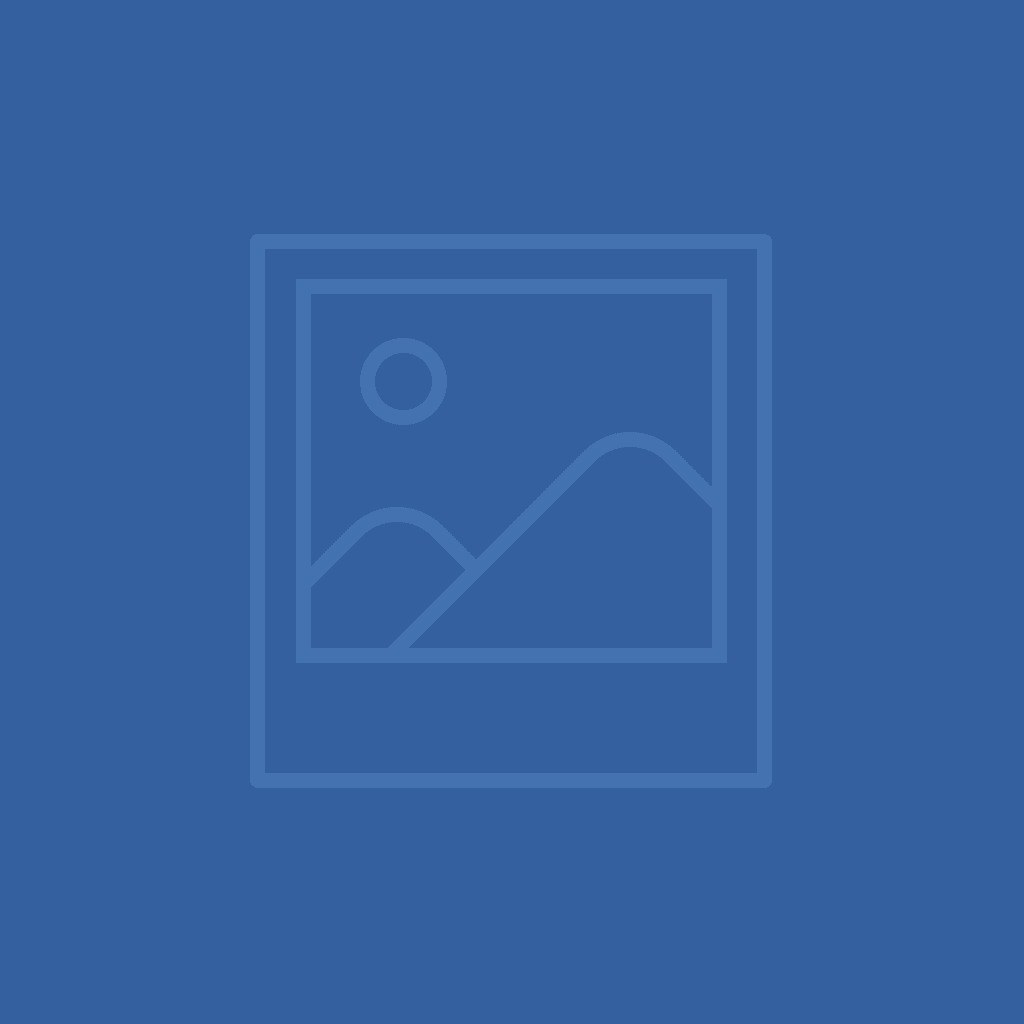IT-Systemintegration – Technologien & Methoden für die Praxis
Die heute gewählte Integrationsmethode bestimmt, wie schnell, widerstandsfähig und kosteneffizient Ihr Unternehmen morgen agieren kann. Dieser Artikel hilft Ihnen, die richtigen Abwägungen zu treffen.
Nachdem Teil 2 die strategischen Muster der Systemintegration beleuchtet hat, zeigt dieser Beitrag, wie sich diese Konzepte mit bewährten Technologien und Methoden konkret umsetzen lassen. Ziel ist es, Integrationsentscheidungen technisch fundiert und zukunftsfähig zu gestalten.
1. Dateibasierte Integration
Daten werden in Formaten wie CSV, JSON oder XML abgelegt und per Dateiübertragung (lokal, FTP, Cloud) ausgetauscht. Häufig erfolgt die Verarbeitung durch geplante Jobs (z. B. Cronjobs).
Typische Muster:
- Batch-Integration
- Pull-Integration
- Punkt-zu-Punkt-Integration
Vorteile: Einfach, kostengünstig, kein Echtzeitbedarf.
Nachteile: Keine Echtzeitsynchronisation, manuelles Fehlerhandling, Risiko von Versionskonflikten und Dateninkonsistenzen, erfordert zusätzliche Validierung und Verarbeitung vor dem Datenimport.
Verwendungszweck: Für regelmäßige Datenübertragungen, bei denen eine Echtzeitverarbeitung nicht entscheidend ist (z. B. nächtliche Batch-Importe).
Technologien: SFTP, AWS S3, Windows Task Scheduler, CSV, XML, JSON file formats.
2. Datenbankbasierte Integration
Zwei Systeme greifen auf eine gemeinsame oder replizierte Datenbank zu. Der Austausch erfolgt über SQL, Trigger oder Replikation. Alternativ können Systeme Datenbankansichten oder ETL-Prozesse verwenden, um Daten unabhängig voneinander zu lesen und zu schreiben.
Typische Muster:
- Synchrone Integration (für direkte Datenbank-Lese-/Schreibvorgänge)
- Batch-Datenintegration (in Replikationsszenarien)
- Eng gekoppelte Integration
Vorteile: Direkter Zugriff, hohe Performance, Nutzung nativer Datenbankfunktionen wie Trigger und Replikation.
Nachteile: Enge Abhängigkeiten, Skalierungsprobleme, Schemaänderungsrisiken, Erhöhtes Risiko der Verletzung der Datenintegrität und Transaktionskonsistenz.
Verwendungszweck: Wenn Systeme schnellen Zugriff auf gemeinsam genutzte Daten benötigen und auf derselben Datenbankumgebung basieren.
Technologien: SQL (PostgreSQL, MySQL, Oracle Database), NoSQL (MongoDB-Replikation, Cassandra), Datenreplikationstools (z. B. Oracle GoldenGate, AWS Database Migration Service).
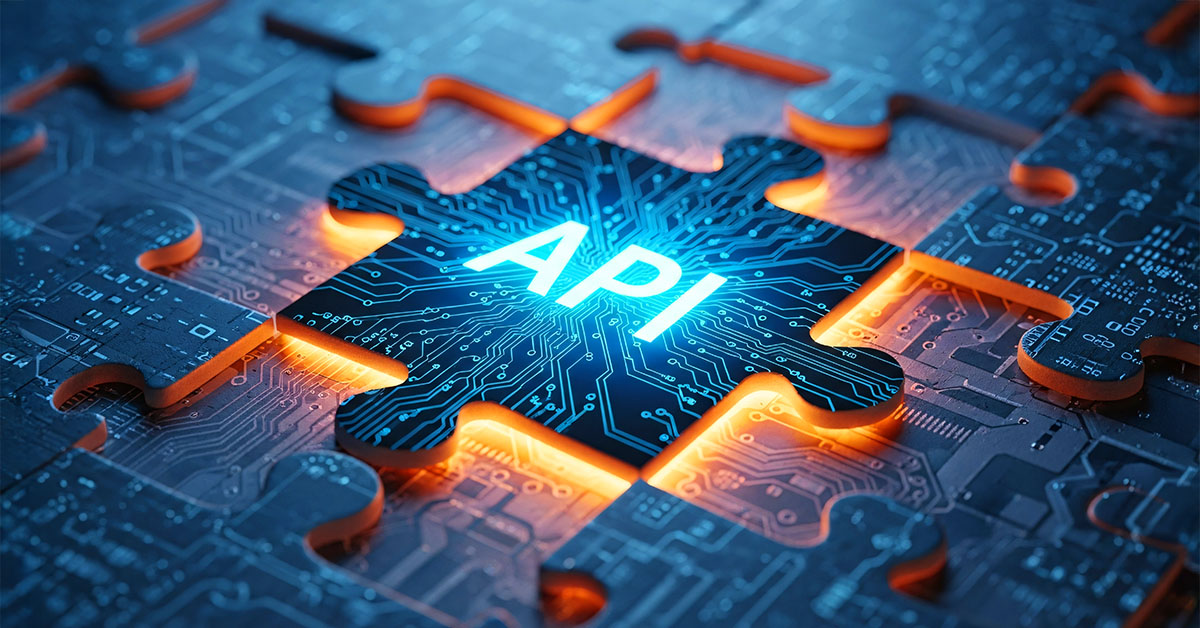
3. API-basierte Integration
Systeme kommunizieren über standardisierte APIs (z. B. REST, SOAP). Die Authentifizierung erfolgt meist über OAuth 2.0 oder JWT.
Typische Muster:
- Synchrone oder asynchrone Integration
- Echtzeit-Integration
- Lose gekoppelte Integration
- Push-Integration
Vorteile: Echtzeitkommunikation, hohe Flexibilität, cloudfreundlich, starke Kontrolle über Zugriff, Sicherheit und Service-Versionierung.
Nachteile: Erfordert API-Management, API-Ausfälle oder grundlegende Änderungen können abhängige Systeme stören, Sicherheitslücken, wenn APIs nicht ordnungsgemäß geschützt sind.
Verwendungszweck: Zur Integration dynamischer Anwendungen, Cloud-Dienste, mobiler Apps und Microservices-Architekturen.
Technologien: REST-APIs, GraphQL-APIs, gRPC, OAuth 2.0, OpenID Connect, JWT, Tools wie Postman, Apigee API Management, AWS API Gateway.
4. Enterprise Service Bus (ESB)
Ein ESB fungiert als zentrale Vermittlungsstelle für Datenflüsse. Er übernimmt Routing, Transformation und Orchestrierung.
Typische Muster:
- Zentralisierte Integration
- Lose gekoppelte Integration
- Asynchrone Integration (oft mit Unterstützung für Messaging-Systeme)
Vorteile: Vereinfacht die Integrationsarchitektur durch Zentralisierung der Verwaltung, unterstützt komplexe Orchestrierung, Datentransformation und Fehlerbehandlung, hohe Skalierbarkeit für große Unternehmensumgebungen.
Nachteile: Höhere Kosten und Komplexität im Vergleich zu direkten Integrationen, bei unsachgemäßer Konzeption kann der ESB zu einem Engpass oder Single Point of Failure werden und erfordert eine robuste Governance und Überwachung, um das „monolithische ESB-Syndrom“ zu vermeiden.
Verwendungszweck: In großen Unternehmen, in denen Dutzende oder Hunderte heterogener Systeme integriert sind.
Technologien: MuleSoft Anypoint Platform, WSO2 Enterprise Integrator, Red Hat Fuse, IBM App Connect.
5. Ereignisgesteuerte Integration
Systeme kommunizieren über Ereignisse (Events), etwa via Apache Kafka oder RabbitMQ. Sender und Empfänger sind entkoppelt.
Typische Muster:
- Asynchrone Integration
- Echtzeit-Integration
- Lose gekoppelte Integration
- Push-Integration
Vorteile: Nahezu Echtzeitverarbeitung mit geringer Latenz, hoher Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit reduziert die Systemkopplung und fördert Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.
Nachteile: Komplexere Ereignismodellierung und Datenflussverwaltung erfordern robuste Ereignisbroker und Überwachungsmechanismen sowie eine erhöhte Schwierigkeit bei der Verfolgung und Fehlerbehebung von Ereignisketten über verteilte Systeme hinweg.
Verwendungszweck: In IoT-Systemen, E-Commerce-Plattformen, Finanztransaktionen und Echtzeit-Analyseumgebungen.
Technologien: Apache Kafka, RabbitMQ, AWS EventBridge, Azure Event Grid.
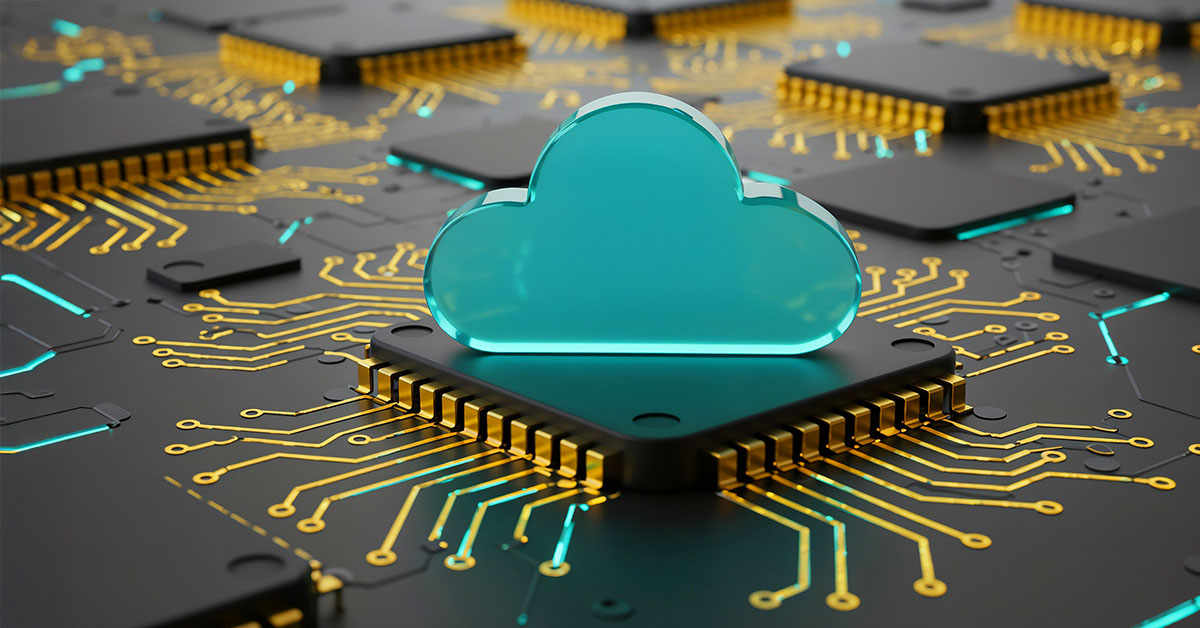
6. iPaaS – Integration-Platform-as-a-Service
iPaaS-Plattformen bieten cloudbasierte, visuelle Integrationstools mit vorgefertigten Konnektoren und Low-Code-Ansätzen.
Typische Muster:
- Zentrale Integration
- Lose gekoppelte Integration
- Echtzeit- und Batch-Datenintegration
- Push- und Pull-Integration
Vorteile: Schnelle Markteinführung dank vorgefertigter Konnektoren und Vorlagen, Unterstützung von Multi-Cloud- und Hybrid-Integrationsszenarien, geringerer Bedarf an tiefgreifendem technischen Fachwissen in frühen Integrationsphasen.
Nachteile: Die Abonnementkosten können mit zunehmender Größe erheblich steigen, die Flexibilität für hochgradig angepasste oder leistungskritische Integrationen kann eingeschränkt sein, und es besteht die Gefahr einer Anbieterabhängigkeit, wenn proprietäre Komponenten in großem Umfang verwendet werden.
Technologien: SAP Cloud Platform Integration (SAP CPI), Informatica Cloud Application Integration (CAI), Dell Boomi, Workato, MuleSoft Composer, Microsoft Power Automate.
7. Hybride Integrationsarchitekturen
In der Praxis setzt sich selten ein einziger Integrationsansatz durch. Erfolgreiche Unternehmen kombinieren verschiedene Methoden je nach Anwendungsfall.
Oft bildet ein übergreifender, ereignisgesteuerter Ansatz das Rückgrat der Architektur. Innerhalb einzelner Domänen werden gezielt API-Aufrufe, Dateiaustausch oder Datenbankzugriffe eingesetzt.
Beispiel:
Wenn eine Bestellung aufgegeben wird:
- Die Bestelldomäne sendet ein „OrderPlaced”-Ereignis an den Event Bus.
- Die E-Mail-Domäne wartet auf dieses Ereignis und löst die Logik zum Erstellen einer Bestätigungs-E-Mail für den Kunden aus.
- Die E-Mail-Domäne verwendet eine API-basierte Integration, um E-Mail-Inhalte aus dem CMS-System abzurufen.
Dieser Ansatz veranschaulicht, wie eine ereignisgesteuerte Architektur als Rückgrat fungiert, während die Punkt-zu-Punkt-API-Kommunikation taktisch eingesetzt wird, wenn eine direkte Interaktion angebracht ist.
Durch hybride Integration können Unternehmen modular bleiben, unnötige Kopplungen vermeiden und die Stärken mehrerer Methoden nutzen – vorausgesetzt, die Integrationsstrategie wird konsequent umgesetzt.
Fazit: Von der Vision zur Umsetzung
Die technische Umsetzung entscheidet maßgeblich über die Zukunftsfähigkeit der Integrationsstrategie. Wer Technologien bewusst entlang der strategischen Muster einsetzt, schafft robuste und skalierbare IT-Ökosysteme. Hybride Architekturen ermöglichen dabei die notwendige Flexibilität, um Fachbereiche, Geschäftsmodelle und Innovationszyklen optimal zu unterstützen.
Das könnte Ihnen auch gefallen:
- Integration von IT-Systemen, Teil 1: Vorteile und Herausforderungen der IT-Systemintegration » Mehr erfahren
- Integration von IT-Systemen, Teil 2: Strategische Muster der IT-Systemintegration » Mehr erfahren
- Digitalisierungsprojekte – 6 wichtige Fakten zu Herausforderungen, Erfahrungen und Anregungen » Mehr erfahren
- Kosteneinsparungen bei der Softwareentwicklung » Mehr erfahren
- Erfolgreiche Software Delivery: Wie man Hürden bei der Entwicklung überwindet » Mehr erfahren
- Low-Code — Die Grenzen des Hypes » Mehr erfahren